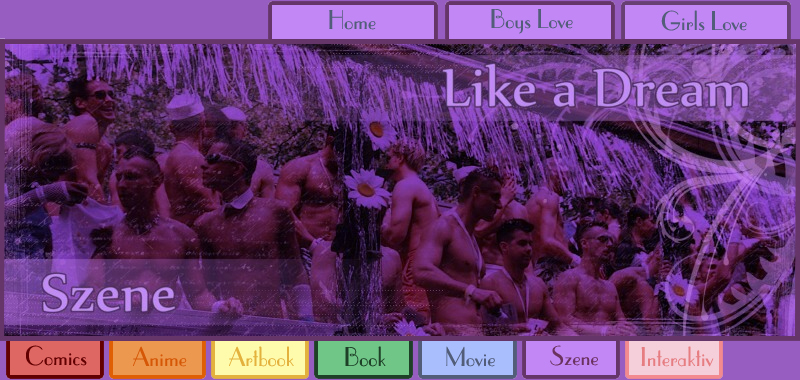
Stefan George (Gastbeitrag: Tanja Meurer)
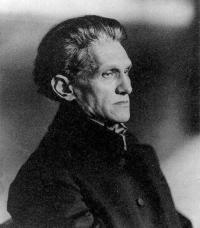 Stefan
Anton George, geb. 12. Juli 1868 in Bingen/ Büdesheim (Deutschland), gest.
04.12.1933 in Minusio (bei Lorcano/ Schweiz)
Stefan
Anton George, geb. 12. Juli 1868 in Bingen/ Büdesheim (Deutschland), gest.
04.12.1933 in Minusio (bei Lorcano/ Schweiz)
Der Lyriker Stefan George gehört zu jenen schillernden Persönlichkeiten, die Bildung, Äsethik und den Zauber einer vergangenen Epoche aus dem 19. Jahrhundert in das vom ersten Weltkrieg verrohte 20. mitbrachte. Er zählte zu Anfang zu den Dichtern des Symbolismus, wendete sich aber im Lauf der Zeit anderen Ausdrucksformen der Lyrik zu.
Bereits in seiner Schulzeit zeigte sich sein unglaubliches Sprachtalent. Um Bücher in der Entsehungssprache zu lesen, lernte er sich selbst in Italienisch, Hebräisch, Griechisch, Latein, Dänisch, Niederländisch, Polnisch, Englisch, Französisch und Norwegisch an. Mittels dieser Begabung entwickelte er eigenständige Geheimsprachen.
1887/ 1888 gab er seine
ersten Gedichte in der von ihm und seinen Schulfreunden veröffentlichten Zeitung
„Rosen und Disteln“ heraus. 1901 sollten etliche dieser Stücke in den Band „Die
Fibel“ aufgenommen werden.
Nach seiner Schulzeit reiste er durch verschiedene
europäische Städte, um dort andere Dichter des Symbolismus zu treffen. Besonders
der in Paris ansässige Dichterkreis um Stéphane Mallarmé festigte seinen
positive Haltung gegenüber dem Symbolismus und gegen die in Deutschland modernen
Ausdrucksformen des Realismus und Naturalismus. Unter anderem gehörte zu seinen
Kontakten der Dichter Paul Verlaine.
Nach drei Semestern Philosophie,
Romanistik, Anglistik, Germanistik und Kunstgeschichte in der Universität
Berlin, brach George 1891 sein Studium ab und reist erneut durch europäische
Städte. In dem gleichen Jahr lernte er in Wien den neunzehnjährigen Lyriker Hugo
von Hofmannsthal kennen und lieben. Die Freundschaft war kurz, intensiv und
zerstörerisch. Der charismatische George besaß das Talent, Menschen zu
beeinflussen, zu vereinnahmen und zu dominieren, was Hofmannsthal über längere
Zeit hinweg zu zerstören begann. Stefan George empfand für seinen jüngeren
Freund eine tiefe körperliche Liebe, die von dem jungen Mann nicht erwidert
wurde. Zugleich erwartete der sechs Jahre ältere George von Hofmannsthal die
vollständige Unterwerfung in ihrer Freundschaft. Er erkannte auch die Dichtung
seines jungen Freundes nur dann an, wenn die Verse von absoluter künstlerischer
Vollkommenheit waren. Hofmannsthal schrieb für Georges (und Carl August Kleins)
Zeitungsprojekt „Blätter für die Kunst“ (1892 – 1919) Prosa, Lyrik, aber auch
Rezensionen. Der junge Aristokrat wünschte sich zunehmend die Freiheit aus den
Fesseln seines Mentors. Hofmannsthal sehnte sich nach Anerkennung durch
Publikum, während George Kunst um der Kunst willen schuf. Zunehmend entzweiten
sich die Freunde.
Schließlich kommunizierten beide Männer nur noch
brieflich, woraus eine augenscheinliche Abhängigkeit und Hassliebe entstand.
Hofmannsthal schrieb an George: „wie vereinsamt wir in Deutschland sind und wie
im tiefsten auf einander hingewiesen“. 1902 und 1905 baute er die schwierige
Beziehung zu seinem Freund in seine Stücke „Der Brief“ und „Jedermann“ ein. Der
Monolog aus „Jedermann“ stellt seine Abrechnung mit George dar: „Nie wieder dein
Aug in meinem, deine Antwort auf meine Frage. Nie wieder! (…) Zwischen uns ist
Hurerei und Scheißdreck. Es war Narretei, ein ödes Hin- und Herzappeln. Eine
Sache wie Leichenschändung.“
1906 zerbrach die Freundschaft endgültig.
In dieser Zeit traf George auf einen zweiten, für ihn schicksalhaften jungen
Mann.
1902 begegnete ihm der damals 14 Jahre alten Maximilian Kronberger in
München. Fasziniert von dem schönen Jungen führte er ihn in seinen Zirkel ein.
Allerdings stilisierte er den Knaben, den er Maximin nannte, zu dem „wahren
Göttlichen“ hoch. Binnen von zwei Jahren erhob sich ein wahrer Kult um
Maximilian, den der Junge beenden wollte, als er sich in ein gleichaltrigen
Mädchen verliebte. Leider kam der Junge von einem Familienbesuch krank zurück
und starb an seinem 16. Geburtstag. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er 241
Gedichte geschrieben.
Ab 1892 hielt George öffentliche Lesungen, auf denen es ihm immer gelang, seine Zuhörer zu fesseln. Auf diesem Weg bildete sich um ihn ein Zirkel von Jungautoren, Dichtern und Künstlern, wie Zeitgleich in London um Oscar Wilde. Mit ähnlich fesselnder Macht band George die Menschen an sich. Zu ihnen gehörten Paul Gerardy, Karl Wolfskehl und Ludwig Klages. Nach 1900 änderte sich die Struktur des Zirkels geringfügig. Weitere - besonders sehr junge – Männer stießen hinzu. Unter ihnen auch Friedrich Gundolf und die drei Brüder Stauffenberg, wovon besonders der jüngste Claus Schenk Graf von Stauffenberg tragische Berühmtheit durch sein Attentat auf Adolf Hitler im Jahr 1944 erhielt. Jener junge Mann verehrte George als den Meister bis zu seinem Lebensende. Was die wenigsten wussten: auch er schrieb. Aus seinem Nachlass existiert bis heute ein Manuskript, das er in einer stilisierten Form an die Handschrift seines Mentors anlehnte.
George liebte es, sich mit schönen Knaben und jungen Männern zu umgeben. Er entsandte seine Schüler, um ihm nach seinen Vorgaben solche Jungen zu suchen. Manchmal nutzte er seine Verbindungen, um an sie heran zu kommen. Oft lagen ihm sie George schon nach dem ersten Treffen zu Füßen. Er genoss die Verehrung und Liebe dieser Jungen, nutzte ihre Rivalität untereinander, um sich ihrer Liebe sicher zu sein und koordinierte seine Treffen mit ihnen mit akribischer Genauigkeit. Einige Knaben ließ er aus Italien und Spanien kommen. Er nutzte seine Macht über Menschen, um diese teilweise dreizehnjährigen Kinder zu unterwerfen. Sie vergötterten ihn dafür. Dennoch schien er nie glücklich zu sein.
Die unterdessen eher religiös
prophetischen Gedichte nahmen nach all den privaten Schicksalsschlägen immer
düsterere Züge an. Zu Beginn des ersten Weltkrieges bescheinigte George diesem
unseligen Unterfangen keinen guten Ausgang. Er war kein Kriegstreiber und
Propagandist. Nach Ende des Krieges sah er sich bestätigt. Umso mehr scharten
sich nun kunstliebende Jugendliche um ihn. Klaus Mann drückte sich dahingehend
so aus: „Inmitten einer morschen und rohen Zivilisation verkündete, verkörperte
er eine menschlich-künstlerische Würde, in der Zucht und Leidenschaft, Anmut und
Majestät sich vereinen.“
1927 wurde ihm der erste Goethepreis der Stadt
Frankfurt am Main verliehen, den er ablehnte.
1928 veröffentlichte er sein
Spätwerk „Das neue Reich“. Die NS-Regierung wollte ihn hiernach zu ihren
propagandistischen Zwecken einspannen, was er ebenso ablehnte wie einen
Ministerposten, der ihm von Joseph Goebbels angeboten wurde. Sogar zu der von
der NS veranstalteten Feier seines 65 Geburtstags blieb er fern. Bereits
erkrankt, reiste er 1933 in die Schweiz, wo er am 04.12. verstarb. Er wurde in
Minusio bestattet. Die Brüder Stauffenberg wohnten seiner Beerdigung bei.
Gedichte
Die Fibel (frühe Gedichte, erst 1901
veröffentlicht)
Hymnen (1890)
Pilgerfahrten (1891)
Algabal (1892) (der
Name bezieht sich auf den römischen Kaiser Elagabal)
Die Bücher der Hirten-
und Preisgedichte der Sagen und Sänge und der hängenden Gärten (1895)
Das
Jahr der Seele (1897; Text beim Projekt Gutenberg)
Der Teppich des Lebens und
die Lieder von Traum und Tod mit einem Vorspiel (1900; Text beim Projekt
Gutenberg
Baudelaire. Blumen des Bösen. Umdichtungen (1901)
Tage und Taten
(1903)
Zeitgenössische Dichter. Umdichtungen. 2 Bände (1905)
Maximin. Ein
Gedenkbuch (1906) (v. George herausgegeben, enth. auch Gedichte anderer)
Der
siebente Ring (1907)
Dante. Stellen aus der Göttlichen Komödie (1909)
Shakespeare Sonnette. Umdichtungen (1909) ISBN 978-3-608-95117-2
Dante.
Göttliche Komödie (Öffentliche Ausgabe. 1912)
Der Stern des Bundes (1914;
Text beim Projekt Gutenberg)
Der Krieg (1917)
Drei Gesaenge: An die Toten,
Der Dichter in Zeiten der Wirren, Einem jungen Führer im Ersten Weltkrieg (1921)
Das neue Reich (1928)
Briefwechsel
Briefwechsel zwischen George und Hofmannsthal.
Hrsg. von Robert Boehringer (1938)
Stefan George / Friedrich Wolters:
Briefwechsel 1904–1930. Herausgegeben von Michael Philipp. Castrum Peregrini
Presse, Amsterdam 1998 (= Castrum Peregrini 233–235)
Briefe. Melchior Lechter
und Stefan George. Hrsg. von Günter Heintz. Hauswedell, Stuttgart 1991. ISBN
3-7762-0318-8
Briefwechsel. Stefan George und Ida Coblenz. Hrsg. von Georg
Peter Landmann und Elisabeth Höpker-Herberg. Klett-Cotta Stuttgart, 1983. ISBN
3-608-95174-1
